
Wir müssen (wieder) über Klasse sprechen
Der Band «Ethnografisch forschen mit Klasse» von Felix Gaillinger und Anna Klaß beschäftigt sich mit der Bedeutung der Strukturkategorie und Erfahrungsgrösse Klasse im Kontext sozialer Ungleichheit und versammelt Beiträge, in denen ethnografische Forschungserfahrungen und biografische Zugänge aus einer klassensensiblen Perspektive analysiert werden. In ihrer Rezension reflektiert Sophie Schönholzer die zentralen Anliegen, Möglichkeiten und Grenzen des Bandes.
Felix Gaillinger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien, und Anna Klaß, ehemals am Institut für Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der LMU München und heute als politische Bildnerin und Pädagogin in einem Münchner Bildungskollektiv tätig, sind die Herausgeber:innen des 86. Bands der Reihe Kulturanthropologie Notizen. Klaß und Gaillinger widmen sich der Frage, welche Bedeutung und Rolle die Strukturkategorie und Erfahrungsgrösse Klasse in der ethnografischen Forschungspraxis einnimmt. Sie argumentieren, dass ein Fokus auf Klasse eine kritische Kulturwissenschaft, die sich mit sozialen Ungleichheiten auseinandersetzt, entscheidend verdichten kann.
Klassenanalytische Ansätze bieten, so Gaillinger und Klaß, die Möglichkeit, ideologiekritisch und reflexiv zu arbeiten. Das bedeutet, dass die Entstehung und Erfahrung klassenbezogener Ungleichheiten auf mikro-, makro- und mesoanalytischer Ebene in einen Zusammenhang gestellt und ihre Wechselwirkungen mit anderen Diskriminierungsformen wie Sexismus und Rassismus berücksichtigt werden. Um soziale Ungleichheiten verstehen und analysieren zu können, so Gaillingers und Klaß‘ Ausgangsthese, darf die Strukturkategorie Klasse in der ethnografischen Forschung nicht weiter vernachlässigt werden. Sie knüpfen an die Diskussionen des US-amerikanischen Soziologen Erik Olin Wright über Klassenanalyse an. Wright plädiert dafür, dass unterschiedliche theoretische und empirische Ansätze zur Analyse von Klassen weniger gegensätzlich betrachtet werden sollten.[i] So beschreibt er auch, dass Studierende, die sich für Klassenanalysen interessieren, häufig das Gefühl haben, sich einem einer theoretischen Schule verpflichteten Klassenverständnis zuordnen zu müssen, ohne andere Verständnisse berücksichtigen zu dürfen. Wright betont jedoch, dass eine Klassenanalyse, die auf der Kombination unterschiedlicher Ansätze basiert, besonders produktiv sein kann, da die jeweiligen Ansätze einen unterschiedlichen Fokus setzen und in ihrer Verbindung eine besonders breite Perspektive ermöglichen.[ii] Gaillinger und Klaß schliessen an dieser These an und untermauern sie, indem sie anhand ihrer eigenen Forschung zeigen, inwiefern verschiedene Ansätze der Klassenanalyse – entgegen verbreiteten Annahmen in den Sozial- und Kulturwissenschaften – einander bedingen und ergänzen können, statt ausschliessen müssen.
Neben der Einleitung der Herausgeber:innen verfassen insgesamt sechs Autor:innen fünf Beiträge, die sich mit der Rolle von Klasse in ihrer Forschungspraxis innerhalb der empirischen Kulturwissenschaften auseinandersetzen. In ihren Beiträgen widmen sich die Gastautor:innen u.a. der Frage, wie sich die eigene Klassenposition und -herkunft produktiv in die eigene Forschung einbringen lassen. Die Mehrheit der Autor:innen versteht sich als «Klassenübergänger:innen», die sich innerhalb und zwischen unterschiedlichen Klassen bewegen. Sie empfinden sich weder als vollständig aufgestiegen noch eindeutig der Klasse zugehörig, der sie ursprünglich entstammen.
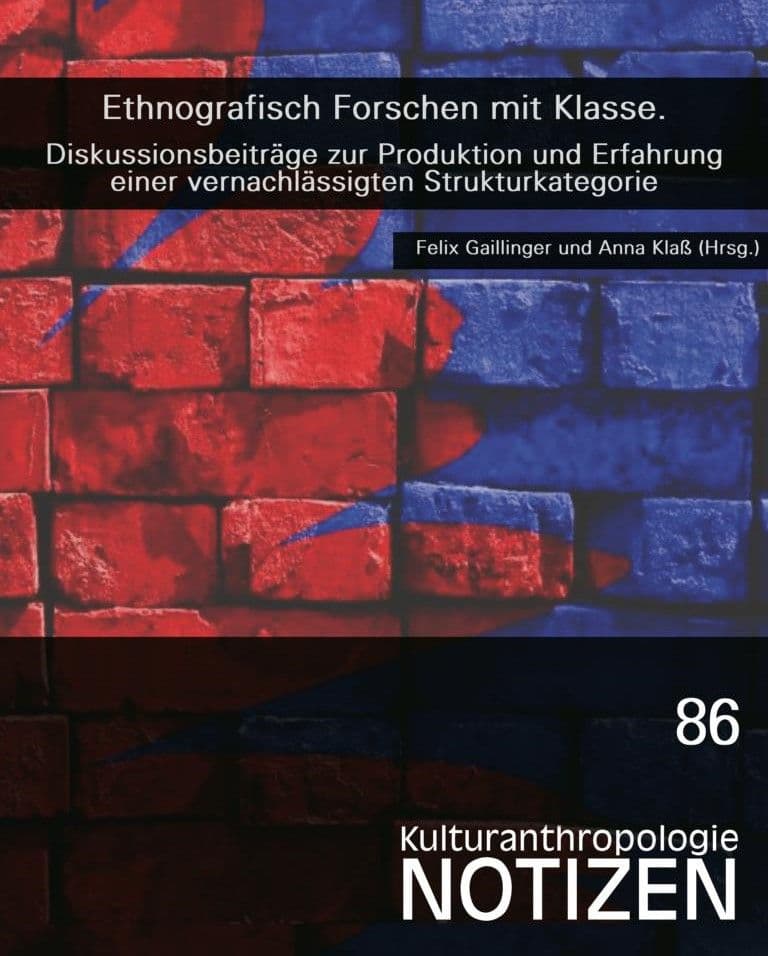
Einblicke in die einzelnen Beiträge
Lydia Maria Arantes bespricht in ihrem Beitrag From Practice to Theory and Back Again? How Mixed-Class Backgrounds Shape Academic Trajectories die Gegebenheit, dass sich Klassenprägungen häufig nicht eindeutig festlegen lassen. Sie wählt einen autoethnografischen Zugang, um ihre eigene Klassen(un)zugehörigkeit zu reflektieren. Marion Hamm und Janine Schemmer setzen sich in ihrem Beitrag Klasse als performativer Prozess in Ethnografie und Forschungsalltag für ein prozessuales und dynamisches Verständnis des Klassenbegriffs ein. Sie nutzen dazu den Begriff der «Klassenreise»[iii], der multiple Positionierungen im Klassenspektrum zulässt und sich gegen die Vorstellung einer linearen Bewegung von «unten nach oben» wehrt. Zugleich argumentieren sie, dass Klasse stets in Verbindung mit weiteren Ungleichheitskategorien zu denken ist, damit soziale Verhältnisse möglichst umfassend analysiert werden können. Carolin Loysa befasst sich in ihrem Text Dismantling the Ethnographer’s House. On Mexican Middle Classes and Shopping Malls mit Klassenverhältnissen in der mexikanischen Stadt Puebla. Sie untersucht die Strukturkategorie race als eng mit Klasse verknüpft und bietet damit eine intersektionale Perspektive auf Ungleichheitsverhältnisse. Natalia Picaroni-Sobrado geht in ihrem Beitrag «Sie dürfen nicht schwarzfahren, Frau Magistra!» Überlegungen zur Klassendimension zwischen Alltagsleben und ethnografischer Forschungspraxis der Frage nach, wie klassenspezifische Selbst- und Fremdkategorisierungen ihre ethnografische Forschung in Chile und Uruguay beeinflussen. Anhand teilnehmender Beobachtungen zeigt sie, wie Klassenkategorisierungen ihre Forschungspraxis prägen. Im abschliessenden Text Klasse und/oder Klassismus? Zum Umgang mit einer begrifflichen Differenz widmet sich Stefan Wellgraf der Kontroverse um die Begriffe «Klasse» und «Klassismus» im deutschsprachigen Raum. Er zeigt anhand seiner Forschung zu Berliner Hauptschulen, wie diese Begriffe sich ergänzen und insbesondere in den empirischen Kulturwissenschaften produktiv genutzt werden können.
Kritische Anmerkungen zum Band
Der Band unterstreicht Gaillingers und Klaß‘ Ausgangsthese; die Auseinandersetzung mit der Strukturkategorie und Erfahrungsgrösse Klasse ist für eine kritische Kulturwissenschaft, die soziale Ungleichheiten untersucht, von zentraler Relevanz. Obgleich die Autor:innen in sehr unterschiedlichen Forschungsfeldern arbeiten, erweist sich die Auseinandersetzung mit Klasse in allen genannten Bereichen als wesentlich für das Verständnis sozialer Ungleichheiten. Auch die Frage danach, wie sich die Klassenposition und -herkunft von Forschenden produktiv in die eigene Forschung einbeziehen lässt, wird von den sechs Gastautor:innen breit diskutiert. Während sich kein abschliessender und in diesem Sinne «richtiger» Ansatz für den Umgang mit der eigenen Klassenposition und -herkunft herauskristallisiert, erweitern die Autor:innen den Diskurs um Situiertheit in der Forschung, indem sie vielfältige Ansätze um Situiertheit aufzeigen. Gleichzeitig setzt die Einleitung theoretische Ansprüche, die nicht in allen Beiträgen umgesetzt werden. Insbesondere das Argument, dass die Klassenanalyse andere Ungleichheitsdimensionen mitdenke, löst sich nicht in allen Texten ein. Die Verknüpfung von Klasse mit anderen Kategorien sozialer Ungleichheit bleibt oft unberücksichtigt. Während die Beiträge zu südamerikanischen Kontexten, wie jene von Picaroni-Sobrado und Loysa, die Verflechtungen von Klasse mit weiteren Strukturkategorien wie race analysieren, bleiben die entsprechenden Reflexionen in den Texten zum deutschsprachigen Raum häufig an der Oberfläche oder finden gar nicht statt. Auch wenn die Zusammensetzung des Bandes insgesamt eine recht umfassende – und in seinem Zusammenspiel auch intersektionale – Perspektive auf Ungleichheitsverhältnisse gibt, hätte ich in den einzelnen Texten eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Verknüpftheit von Klasse mit anderen Ungleichheitskategorien für relevant gehalten.
In einigen Beiträgen wird thematisiert, dass die akademische Beschäftigung mit Klasse und Klassismus in gewisser Weise stets in einem grundlegenden Widerspruch zur strukturell bürgerlichen universitären Forschung steht. Picaroni-Sobrado fragt in diesem Zusammenhang, welchen gesellschaftlichen Beitrag Forscher:innen mit ihrer Lehr- und Forschungspraxis leisten können, wenn sie – wie ein Student während ihrer Feldforschung meinte – keine Ahnung haben, wie die Mehrheit der Menschen im Land lebt, oder zumindest von Studierenden und Forschungssubjekten so wahrgenommen werden? Ich halte es für äusserst relevant, dass dieses Spannungsfeld thematisiert wird – gleichzeitig löst es sich dadurch nicht auf. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, wie und ob im Bewusstsein um diesen Widerspruch sinnvoll zu Klasse geforscht werden kann. Diese und weitere Fragen bleiben offen. Die Texte des Bandes eröffnen jedoch zweifellos eine breite Debatte und liefern wertvolle Denkanstösse, um diese Fragen zu diskutieren. Sie schaffen einen fruchtbaren Boden für Gaillingers und Klaß‘ Anliegen, in den empirischen Kulturwissenschaften (wieder) über Klasse zu sprechen, und erweisen sich dadurch als äusserst lesenswert.
Zitation
Sophie Schönholzer, Wir müssen (wieder) über Klasse sprechen, in: das.bulletin, 25.03.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/wir-muessen-wieder-ueber-klasse-sprechen.

