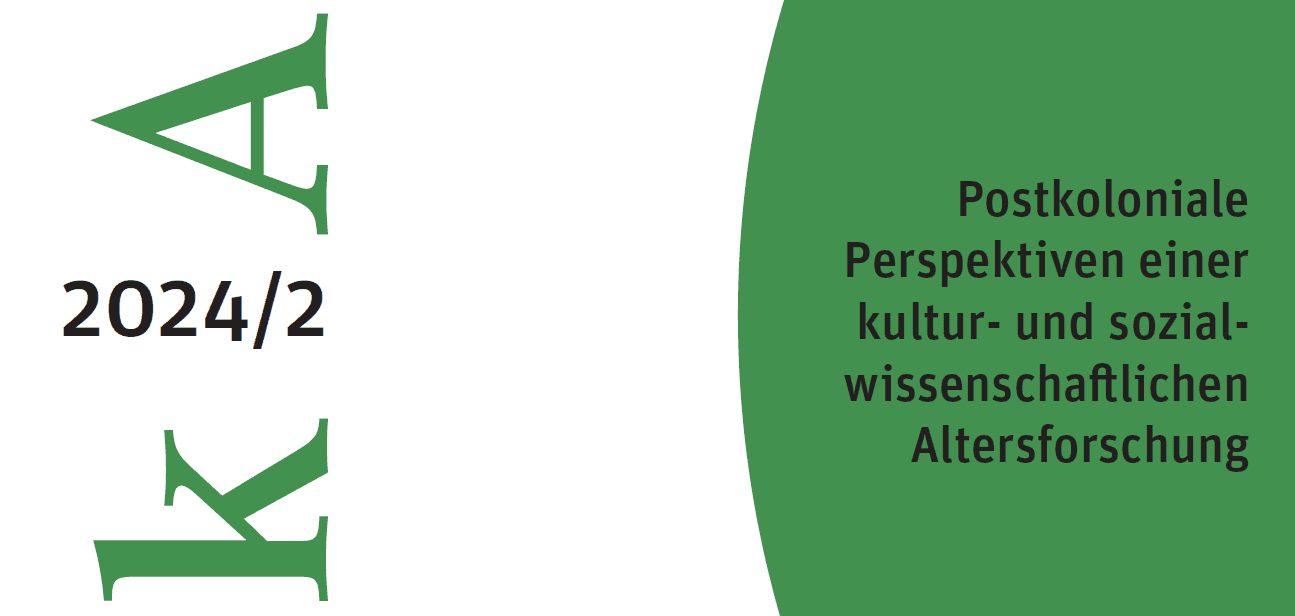
Postkoloniale Perspektiven einer kultur- und sozialwissenschaftlichen Altersforschung
Valerie Keller und Eva-Maria Trinkaus haben die zweite Ausgabe 2024 des SAVk, ein Themenheft mit dem Titel «Postkoloniale Perspektiven einer kultur- und sozialwissenschaftlichen Altersforschung» herausgegeben. Wir haben ihnen drei Fragen gestellt.
1. Valerie Keller und Eva-Maria Trinkaus – wie ist es zu dieser Sonderausgabe gekommen?
Valerie Keller: Der Anfang dieser Kollaboration markierte ein sommerliches Abendessen anlässlich einer interdisziplinären Tagung zu kulturgerontologischen Perspektiven auf das Alter(n). Es entstand ein intensives Gespräch dazu, ob Menschen mit Demenz – wie in einem Vortrag vorgeschlagen – als Subalterne verstanden werden können, oder ob dieses Konzept, das aus den Postkolonialen Studien entlehnt wurde, für mehrfachprivilegierte Personen mit Demenz etwas fehlgeleitet sein könnte. Wir waren uns einig, dass theoretische Konzepte und Forschungsmethoden aus den Posktolonialen Studien längst in unterschiedliche alterswissenschaftliche Forschung Einzug genommen haben und dass sich diese Herangehensweise auch durchaus als fruchtbar gezeigt hat, um das Alter als Differenzierungskategorie und damit verbundene Machtverhältnisse sichtbar zu machen. Trotzdem konnten wir ein grundsätzliches Unbehagen nicht ablegen: Das hohe Alter unterscheidet sich in vieler Hinsicht von Diskriminierungsmerkmalen, die aus kolonialistischen und imperialistischen Herrschaftsverhältnissen resultieren. Dieses Spannungsverhältnis wollten wir nicht im Restaurant stehen lassen, und organisierten einen interdisziplinären Forschungsworkshop zu Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Zusammenschau von Alterswissenschaften und Postkolonialen Studien. Das Themenheft, das nun beim Schweizerischen Archiv für Volkskunde erscheint, ist eine auf diesen Gesprächen basierende Weiterführung der Diskussion.
Eva-Maria Trinkaus: Ja genau, da wir unsere beiden Perspektiven hier um weitere Stimmen aus dem deutschsprachigen Wissenschaftskontext (DACH) erweitern wollten, haben wir dann die Arbeitstagung in der Schweiz organisiert um zu sehen, wo denn solche Konzepte abseits der bereits publizierten Studien Anwendung finden. Für mich als Amerikanistin ist so eine Anwendung im deutschsprachigen Kontext ja zu Beginn doch etwas befremdlich gewesen, da Konzepte aus den Postkolonialen Studien und damit einhergehende Machtstrukturen nicht einfach übertragen werden können – vor allem nicht dann, wenn der Kontext eine andere oder keine Kolonialgeschichte aufweist als die, in der die Theorie zu verorten ist. Vor allem in der Übertragung und Verwendung von Konzepten hat die Literaturwissenschaftlerin Emily Timms bereits grandiose Arbeit geleistet, die sensibel auf dieses Potential der doppelten Unsichtbarmachung eingeht und vor einer Übersimplifizierung warnt. Dem wollten wir auch gerecht werden, was uns auch im Austausch mit Forscher*innen abseits des Sammelbandes gelang, zu dem der Sammelband angeregt hat (hier gilt vor allem Malte Völk und Ulla Kriebernegg ein spezieller Dank für ihre Einblicke, Vorschläge und das Weiter-Denken!).
2. Was hat Euch bei der Arbeit am Themenheft überrascht?
Valerie Keller: Die sehr unterschiedlichen Herangehensweisen je nach Fachhintergrund!
Eva-Maria Trinkaus: Da wir uns da an einen multidisziplinären Austausch gewagt haben, war es wirklich spannend zu beobachten, welche Prozesse des Verstehens und des Theoriebildens in diesen beiden, breiten Feldern möglich waren. Auch die Präsentation von Beiträgen aus dem Special Issue während des Annual Meetings der Gerontological Society of America und der anschließende Austausch mit Amanda Grenier, Ulla Kriebernegg, Stephen Katz etc. hat noch einmal verdeutlicht, dass man hier sehr sensibel mit den Überlappungen der beiden Felder umgehen muss - vor allem auch, dass Brücken nur dann gebaut werden, wenn Entlehnungen nicht nur einseitig passieren, sondern ein beidseitiger Austausch stattfinden kann, der auf Augenhöhe passiert. Was für mich, und ich glaube ich spreche damit aber für uns beide, am allerbesten funktioniert hat, waren die Diskussionen und erweiterten Fragestellungen, die sowohl unsere eigenen blinden Flecken sichtbar gemacht haben, uns aber auch gezeigt haben, wo die Grenzen des Möglichen sind. Und auch wenn besagter beidseitiger Brückenschlag nur bedingt möglich war, so waren es vor allem die Gespräche rund um das Thema, das ob seiner Sensibilität doch viele verschiedene Meinungen zusammengeholt hat, die eine Bereicherung für unsere Forschung waren. Davon nehmen wir uns, denke ich, am meisten mit, auch wenn diese Weiterführung im Sammelband noch gar nicht thematisiert werden konnte, da dieser erst Anlass für die Gespräche war.
3. Und zu guter Letzt: Warum lohnt es sich, Eure Ausgabe zu lesen?
Valerie Keller: Im Themenheft werden einerseits Diskriminierungsformen und Machtungleichheiten herausgearbeitet, andererseits auch Räume sichtbar gemacht, in denen ein Anderssein in lebensbejahender und lustvoller Weise gelebt werden kann. Im Fokus stehen erstens Lebensrealitäten von Münchner Frauen hohen Alters mit niedrigem Einkommen, zweitens Eltern von LGBTQIA+ Personen, die im postsozialistischen China ihr Alter nicht von einer heterosexuellen Matrix vorgegebenen Grosselternrolle leben, drittens eine migrantische Bevölkerung in Österreich, die eigenwillige Interpretationen medizinischen Fachwissens anstellen und viertens Menschen mit Demenz, die abseits öffentlich-politischer Mitsprache Praktiken entwickeln, die subversives Potenzial mitbringen. Die Diskussion um Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Zusammenschau Postkolonialer Theorie und Alterswissenschaften ist damit aber noch längst nicht abgeschlossen, und wir würden uns sehr über weiterführende Forschungen und den Austausch dazu freuen.
Eva-Maria Trinkaus: Und weil gerade die kritischen Diskussionen, die daraus resultieren, Forschung weiter vorantreiben und noch besser und reflektierter machen.
Neugierig geworden? Hier geht es zur Heftausgabe.
Valerie Keller, Eva-Maria Trinkaus (Hg.): Postkoloniale Perspektiven einer kultur- und sozialwissenschaftlichen Altersforschung. Schweizerisches Archiv für Volkskunde (SAVk) 120 (2024/2).
Zitation
Valerie Keller, Eva-Maria Trinkaus, Postkoloniale Perspektiven einer kultur- und sozialwissenschaftlichen Altersforschung, in: das.bulletin, 16.01.2025, URL: https://ekws.ch/de/bulletin/post/postkoloniale-perspektiven-einer-kultur-und-sozialwissenschaftlichen-altersforschung.

Valerie Keller

